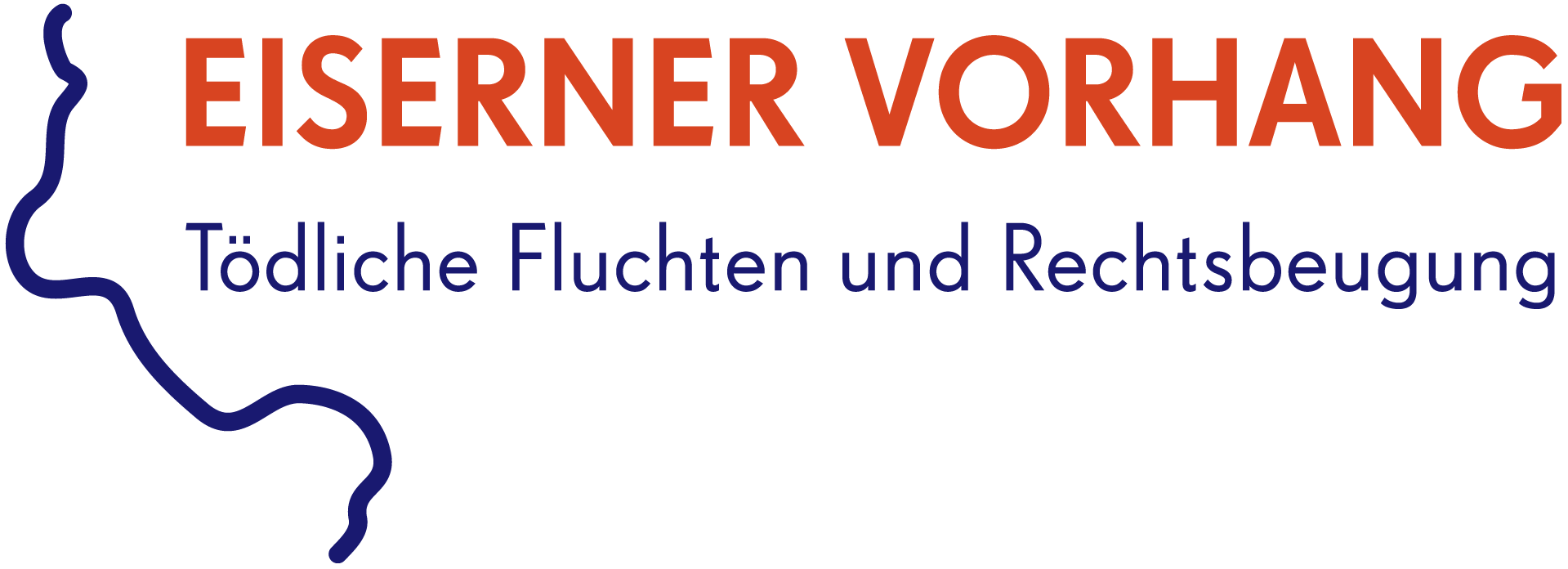Werner Siegfried Kalina wurde am 19. August 1944 in Radibor in Sachsen geboren. Er war das einzige Kind seiner alleinerziehenden Mutter, die nach dem Tod des Vaters nicht noch einmal heiratete. Sie betrieb einen Großhandel für Lederwaren direkt am Markt in Crimmitschau. Werner Kalina machte von September 1960 bis Februar 1963 eine Ausbildung bei der Flugzeugwerft in Dresden und ging gemeinsam mit einem seiner Kameraden aus der Berufsschule, W., zur Abendschule um nebenbei das Abitur zu machen. Mit diesem Kameraden teilte er auch die Leidenschaft für das Fotografieren.die beiden zogen auf der Suche nach guten Bildmotiven des Öfteren auf ihren Fahrrädern gemeinsam durch die Stadt oder das Umland. Ihre Ausbildungsklasse war auch auf Reisen gewesen. Im Winterlager und im Sommerlager ging es an die Ostsee. Vielleicht hatte er da das erste Mal den Gedanken entwickelt, über dieses Meer den Staat zu verlassen.

Zu seinem 19. Geburtstag im August 1963 bekam er ein Motorrad geschenkt, eine MZ-ES. Mit dieser Maschine fuhr er zehn Tage darauf, am 29. August an die Ostsee. Seine Mutter dachte, er würde zu seiner Tante nach Karl-Marx-Stadt [heute Chemnitz] fahren. Doch dort kam er nie an.
Seine Mutter erfuhr, dass das Motorrad im Raum Grevesmühlen bei Klütz gefunden worden sei und setzte am 5. September ein Telegramm an einen Mitschüler Werner Kalinas, G., in Dresden ab, in welchem Sie berichtete, dass ihr Sohn seit dem 29. August spurlos verschwunden sei und die Polizei das Motorrad gefunden habe. Sie bat um Nachricht für den Fall, dass er darüber Bescheid wisse. Am 17. September schrieb die Mutter an diesen Schulfreund, dass sie mittlerweile an „Freunde im Westen geschrieben“ habe und diese nun nachforschten, aber bisher ohne Erfolg.
Während die Mutter noch glaubte, dass Ihr Sohn leben würde und verzweifelt auf ein Zeichen wartete, war dieser schon verstorben: Am 21. September 1963 war um 18:45 Uhr nördlich von Hafthagen, einem kleinen Dorf westlich von Boltenhagen, auf hoher See ein unbekannter Mann tot aus dem Wasser geborgen worden. Die unbekannte Leiche wurde einige Tage darauf in Grevesmühlen beigesetzt. Im selben Monat noch wurde Werner Kalinas Berufsschulkamerad W. in Dresden von der Volkspolizei am Arbeitsplatz aufgesucht und zu dessen Verschwinden befragt. Warum, konnte dieser sich zu dem Zeitpunkt noch nicht erklären.
Am 16. Oktober schrieb die Mutter erneut an den Freund G. Sie teilte ihm mit, dass Ende der vergangenen Woche das Motorrad eingetroffen war und dass es sich in einem nicht-fahrbaren Zustand befunden hatte. Zudem gab es die Unstimmigkeit, dass auf dem Frachtbrief der 1. Oktober als Sendedatum verzeichnet war, die Polizei aber mitgeteilt hatte, dass es schon am 6. September abgeschickt worden sein soll. In diesem Brief wird auch die kritische Haltung der Mutter gegen die SED sichtbar. So kommentierte sie die sich durch den Beruf ergebenen Anstrengungen des Briefpartners mit dem Satz „[…] aber ohne Anstrengung keine Belohnung! Ja, die Leute von der Partei brauchen das weniger, sie schaffen manches mit dem Abzeichen!“
Knapp zwei Wochen darauf, am 29. Oktober schrieb sie erneut an G.: „Noch hoffe ich, aber das macht mein Herz nicht leichter. X mal war ich schon bei der Polizei und immer mußte ich leer ausgehen kein einziges Wort was dazu tragen könnte meine Lage zu erleichtern. Ach, ich habe einen Schreck bekommen als man mir sagte, dass dort ein junger Mensch aus dem Wasser gezogen wurde! Ich mußte sofort zur Polizei und man fragte mich, ob mein Werner einen Goldenen-Zahn und eine eingedrückte Nase hätte! Das traf nicht zu und dann erst habe ich erfahren, dass sie einen Menschen gefunden haben und angenommen, es wäre mein Bub.“ Weiterhin berichtete sie, dass sie vom Roten Kreuz in Hamburg einen Brief erhalten habe, in welchem ihr mitgeteilt wurde, dass die Suchaktion noch nicht abgeschlossen sei und sie noch auf Rückmeldung der Aufnahmelager warteten. Auch in diesem Brief wird der Verdruss über die DDR sichtbar: „Sie schreiben mir, ich soll mich an die Generalstaatsanwaltschaft wenden und ich habe das auch getan, aber darauf keine Antwort erhalten. Ja, die Leute haben viel Zeit und wenn sie es nicht haben – so nehmen sie sich welche! Es ist ihnen auch gleichgültig, ob ein Mensch weniger oder auch mehr ist und das im Staate, wo der Mensch im Vordergrund stehen soll! […] Es ist ein Drama und ich bedaure nur, dass ich hier lebe! Keiner hätte so wenig zur Klärung unternommen wie die Dienststellen der DDR!“
Auch zur Weihnachtszeit bleibt jede Nachricht des Sohnes aus. Frau Kalina schreibt am 20. Dezember 1963 an G.: „Das ich immer noch ohne jede Nachricht bin ist schrecklich […] Na, noch kann ich hoffen, noch habe ich nichts böses erfahren!“
Ein halbes Jahr nach Werner Kalinas plötzlichem Verschwinden hofft die Mutter immer noch auf ein Lebenszeichen. Sie wollte eine Vermisstenanzeige in der Presse aufgeben. Doch auch ihr Unbehagen wird in einem Brief an G. vom 13. Februar 1964 immer deutlicher: „Das Warten ist schrecklich und man kann kaum mehr diese Ungewissheit ertragen. Ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Das ganze Leben ist ganz Sinn und Freudelos. Ich habe in der Zwischen Zeit (sic!) manches unternommen, aber alles leider ohne Erfolg! […] die Polizei hier angerufen und fragte diese, ob ich solch eine Anzeige in der Presse aufgeben dürfte. Man wollte sich erkundigen und bis heute warte ich auch auf diese Nachricht! Nein, das gibt es nur bei uns! Würden wir in einem Staat leben, hätte man mir anders geholfen die Spur zu finden! Erst gestern habe ich wieder angerufen und ich werde, dem Versprechen nach, bald eine Nachricht bekommen. Es ist viel zu lange seitdem unser Werner verschwunden ist. Wer sollte sich heute an eine Begegnung im August erinnern? Nein, man hat mir nicht geholfen, weil man es nicht wollte!“
Am 6. April schrieb sie einen weiteren Brief an G., aus dem hervorgeht, dass es immer noch keine Neuigkeiten zu ihrem Sohn gab. Hier lässt sich erahnen, dass der Vater des Jungen nicht aus dem Krieg wiedergekehrt ist: „Jeden Tag hoffe ich und jeden Tag warte ich umsonst! Das habe ich schon einmal erlebt, doch bei einem Kind ist das alles noch viel schlimmer!“ Weiterhin berichtete sie, dass sie für die geplante Anzeige keine Genehmigung erhalten hatte und bisher niemand etwas hinsichtlich des Verschwindens ihres Sohnes unternommen habe. Ihr Unmut gegen den Staat wird in diesem Brief deutlich, als sie schrieb, dass sie ihr Auto reparieren lassen müsse, „weil man neuerdings keinen Neuen Wagen fürs Geschäft kaufen kann! Das sind mal wieder ‚Helden‘ gewesen, welche solch ein Gesetz ausgearbeitet haben!“
In einem Brief vom 19. Mai 1964 findet sich dann der erste Hinweis, dass auch der verschwundene Sohn nicht zufrieden mit der ihn umgebenden Politik gewesen zu sein schien: „Na, und die Politik erst! Schade, dass die Schulen so politisch geworden sind! Das ist oft der Grund einem die Lust zu lehrnen [sic!] zu nehmen! Mein Bambino hat das besonders schlimm empfunden. Er sagte das nicht oft, aber gefühlt habe ich es und leider konnte ich nichts dagegen unternehmen!“ In diesem Brief wird auch deutlich, wie viel Anstrengung sie als alleinerziehende Geschäftsfrau hatte und dass sie ihrem Sohn zuliebe nicht noch einmal heiratete, aber ihn selbst auch mit „strenger Hand“ erzogen hatte. Dass sie manchmal zu sehr geschimpft hatte, tue ihr nun sehr leid. Sie hoffte weiter, dass er lebte und einmal eine Nachricht gäbe. Es wird auch eine Kritik an der mangelnden selbstbestimmten Bewegungsfreiheit explizit. Sie schrieb: „Leider haben wir nicht viel Gescheites zu erwarten so lange man uns hier gefangen hält und solange Deutschland nicht eins ist! Mein Gott, das wäre kaum auszudenken, wenn einmal die Grenzen fallen! Reinste Völkerwanderung ginge vor sich und keiner wird gezwungen dort zu leben, wo er heute muß! Kann sein, blieben wir dann auch gern zu Hause!“
Noch am 24. Juni 1964 hoffte sie darauf, ein Lebenszeichen ihres Sohnes zu erfahren. Sie wollte sich nicht mit seinem Verschwinden abfinden, wie in einem weiteren Brief an G. zu lesen ist. Sie schrieb ihm, dass sie in Verhandlungen über eine staatliche Beteiligung an ihrem Geschäft sei und den Vertrag voraussichtlich unterzeichnen würde: „[…] würde mir so manche Sorge abnehmen und auch mir noch unbekannte Sorgen mit sich bringen. Nun, mal sehen – habe ich dabei finanzielle Vorteile – werde ich es tun. Aus Idialismus [sic!] bestimmt nicht!“
Nicht einmal zwei Wochen nach diesem Brief, am 2. Juli 1964 hat das starke Klammern am dünnen Strohhalm der Hoffnung dann ein Ende: Durch Hinweise und das Bedürfnis nach Gewissheit angetrieben, lässt sich Frau Kalina an diesem Tag Fotos der Leiche vom 21. September zeigen und erkennt darauf anhand einer Narbe am Bein ihren Sohn. Danach wendet sie all ihre Kraft und Mittel auf, ihren „Bambino“ zu sich holen zu können. Im August werden seine Überreste aus dem anonymen Grab exhumiert und nach Crimmitschau überführt, wo seine Mutter ihn auf dem Städtischen Friedhof beisetzen ließ.